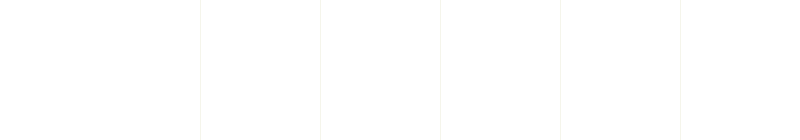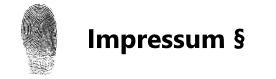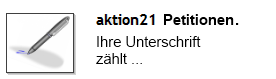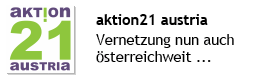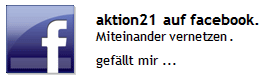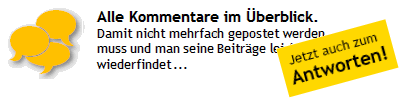Die Demokratie verkümmert - doch wen stört es?
 |
Mittwoch, 25. Juli 2007
Gastkommentar von Dr. Paul Schulmeister in "Die Presse"Das Engagement der Bürger schwindet in vielen Ländern Europas. Wer garantiert, dass aus der latenten Vertrauenskrise nicht eine Legitimationskrise der Demokratie entstehen könnte? Illusionslos hat Bundeskanzler Gusenbauer vor Kurzem festgestellt, nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung interessiere sich tagtäglich für die Politik. Es stimmt, die meisten Menschen wollen heute von der Politik weder belastet noch belästigt werden. Jedenfalls solange der Staat seine Hauptverheißungen erfüllt: für Wohlfahrt und Sicherheit zu sorgen. Wie zukunftssicher ist eine Demokratie ohne engagierte Demokraten? Für Alexis de Tocqueville war der Kern der Demokratie - und die beste Garantie gegen jeden Despotismus - der Bürgersinn. Doch gerade der "esprit de cité" verkümmert. In den Neuenglandstaaten des 19. Jahrhunderts hatte Tocqueville bemerkt, dass es im Spannungsverhältnis von Gleichheit und Freiheit entscheidend darauf ankommt, Chancen und Pflichten im Gemeinwesen als aktiver Bürger wahrzunehmen. Heute schwindet das Engagement in vielen Ländern Europas. Wer garantiert, dass aus der latenten Vertrauenskrise nicht eines Tages eine Legitimationskrise der Demokratie entstehen könnte? Kein Ende der Geschichte Als sich die Prognose des amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama vom "End of history" als falsch herausgestellt hatte, spotteten viele Kommentatoren. Fukuyama war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vom endgültigen Sieg der liberalen Demokratie überzeugt gewesen. Einige Jahre später meinte Ralf Dahrendorf: "Ein Jahrhundert des Autoritarismus ist keineswegs die unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert." In den meisten EU-Ländern sinkt heute die Wahlbeteiligung, die Zahl der ungültig Wählenden steigt, Wahlkämpfe werden immer häufiger populistisch und als "negative campaigning" inszeniert. Glaubt irgendwer, dass das jüngste österreichische "Demokratiepaket" an den kritischen Befunden etwas ändern wird? Seit langem verliert die Politik an Handlungsfähigkeit angesichts großmächtiger Wirtschaftsinteressen - erst recht auf nationaler Ebene ("Brüssel als Sündenbock"); Konflikte werden auf Medieneffekte hin gestaltet (und nach dem Abschalten der Kameras klopfen sich die Gegner auf die Schulter); auf die vagabundierenden Unsicherheitsgefühle der Wählerschaft reagiert der Staat häufig mit Symbolmaßnahmen; beliebt ist auch die Moralisierung von Streitthemen, weil sich so eher Bürgerteilnahme erreichen lässt als mit dem Erfordernis eines hochkomplexen Sachverstands. Schlagwort von der "Postdemokratie" Vor drei Jahren hat der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch das Schlagwort von der "Postdemokratie" geprägt - einer Chiffre für den allmählichen Wandel der liberalen Demokratie hin zu einem autoritären Politikmodell. Crouch dachte dabei weniger an Singapur als an eine Symbolfigur wie Berlusconi. Dieser hatte seine Erfolge nicht nur dem Versagen der Linken, sondern auch seiner fernsehtauglichen Entertainment-Qualität und seiner Mediendominanz zu verdanken. Heute breiten sich überall "postdemokratische" Tendenzen aus: Marketing statt politische Kontroversen, Unterhaltung statt Ernsthaftigkeit, Spin-Doktoren statt Überzeugungstäter, formaldemokratische Rituale statt bürgerschaftliche Spontaneität. Wie wäre dieser Niedergang zu stoppen? Die besten Vorschläge gehen in Richtung Mehrheitswahlrecht und stärkere plebiszitäre Elemente. Doch das Problem liegt mindestens so sehr bei der Demokratiemüdigkeit vieler Bürger. Die verbreitete Ratlosigkeit ruft Beschwichtigungskünstler auf den Plan. Man empfiehlt noch mehr Talkrunden, "Bürgernähe" und "Transparenz" - Leerformeln für eine Fassadendemokratie. Der Berliner Politologe Claus Offe konstatiert nüchtern: "Die Parteien interessieren sich nicht für die Wähler, die Wähler nicht für die Parteien. Die Parteien werden weiter an Kredit verlieren." Zwangsläufig würde mit jeder Enttäuschung der im Wahlkampf geweckten Erwartungen die Verdrossenheit gegenüber der Politik steigen, meint Offe. Mehr als 60 Prozent der Deutschen bezweifeln heute schon das Funktionieren der Demokratie. Politiker, die sich als Außenseiter, Anti-Politiker oder Herausforderer des Establishments stilisieren, können punkten. Auch das erklärt den Höhenflug des demagogischen Heilsversprechers Lafontaine. Das heute praktizierte "Als-ob"-Spiel beruht auf Gegenseitigkeit: Wir Wähler tun so, als würden wir euch Politikern grünes Licht geben (in Wahrheit kümmern uns eure Programme wenig); wir Politiker tun so, als würden wir uns ganz an das halten, was ihr wollt (in Wahrheit wissen wir ja, dass ihr die meisten Sachprobleme gar nicht durchschaut oder durchschauen wollt). Der Virus der Gleichgültigkeit geht um. Oft gewinnt man den Eindruck, dass Politiker-Rücktritte umso seltener stattfinden, je häufiger sie verlangt werden. Dieses Spiel sollte man für unerträglich halten. Siehe da: Alle halten es aus. Und doch passiert nichts anderes als eine ständige Münzverschlechterung in der Grundwährung "Demokratie". Gemach, Gemach!, könnte man ironisch kontern. Wir genießen doch Toleranz und Pluralität wie nie zuvor. Jede Gay-Parade ist eine bunte Selbstfeier des Leben-und-leben-Lassens. Justiz und Polizei funktionieren. Das Hochquellwasser schmeckt köstlich. Die Kultur kann in jeder geförderten Nische glänzen. Vor Kommunalwahlen werden Straßen mit Hochdruck gesäubert und geteert. Sozialpartnergipfel verpacken neue Wohltaten. Die Verantwortlichen verantworten nimmermüde. Der Wähler kann wählen, demonstrieren oder Bürgerinitiativen starten. Es ist eine Lust zu leben. Seltsam nur, dass die Lust an der Demokratie vielen offenbar vergeht. Für das alte Athen fand Aristoteles noch die Formel: Demokratie reicht so weit, wie die Stimme des Herolds trägt. Demokratie also als Frage der Kommunikation und Partizipation. Beides liegt heute im Argen. Die Europäische Union "kommuniziert" tausende Regeln auf zehntausenden Seiten - doch das Publikum versteht immer weniger und beginnt, den Saal dieses Schauspiels zu verlassen. Auch in den Nationalstaaten wächst die Kluft zwischen Wählern und Gewählten. Darüber täuschen nur die kurzatmigen Tagesaufreger hinweg: das "Bin schon weg, bin wieder da"-Dramolett, Sozialfighter statt Eurofighter, die alte Bawag-Führung möglichst in den Knast, Skandale da, Skandale dort, alles garniert mit "Blitzumfragen" unter womöglich nur 300 Befragten. Natürlich bleibt die Kontrollfunktion der Medienöffentlichkeit unersetzlich. Doch man sollte auch nicht die Augen verschließen vor der Symbiose einer oft selbstbezüglichen Medienwelt, der es um Quote und Auflage geht, mit der Welt der Politiker, die fast schon verzweifelt um die kostbare Ressource "Aufmerksamkeit" ringen. Auswanderung aus der Politik Damit Demokratie funktioniert, sind andere Voraussetzungen nötig. Demokratie braucht das ehrliche Ansprechen wirklicher (nicht hochgespielter) Probleme, eine aktive Bürgerbeteiligung und das offene Austragen von Konflikten ohne Scheinharmonisierung. An allen Punkten fehlt es so sehr, dass wir - von der EU-Ebene bis zur Ebene der Kommunalpolitik - zu Zeugen einer leisen, aber kontinuierlichen Auswanderung aus der Politik werden. Wenn die Demokratie stabil bleiben soll - so hat Tocqueville erkannt -, dann sind Entschlossenheit und Kraft der Bürger vonnöten, sich vom Staat nicht bevormunden zu lassen. Die Demokratie zielt gewiss auf Gleichheit. Doch von nichts lebt sie so sehr wie vom Willen und von der Möglichkeit zur Freiheit. Die Bürger müssen sich "in ihre eigenen Verhältnisse einmischen", wie Bert Brecht gesagt hat. In der Demokratie gibt es keine Alternative. Sonst verdunstet unmerklich die Freiheit. Dr. Paul Schulmeister war von 1972 bis 2004 beim ORF, insgesamt 15 Jahre Deutschland-Korrespondent in Bonn und Berlin. Seither freier Journalist in Wien. meinung@diepresse.com ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2007) [ zurück ]
|